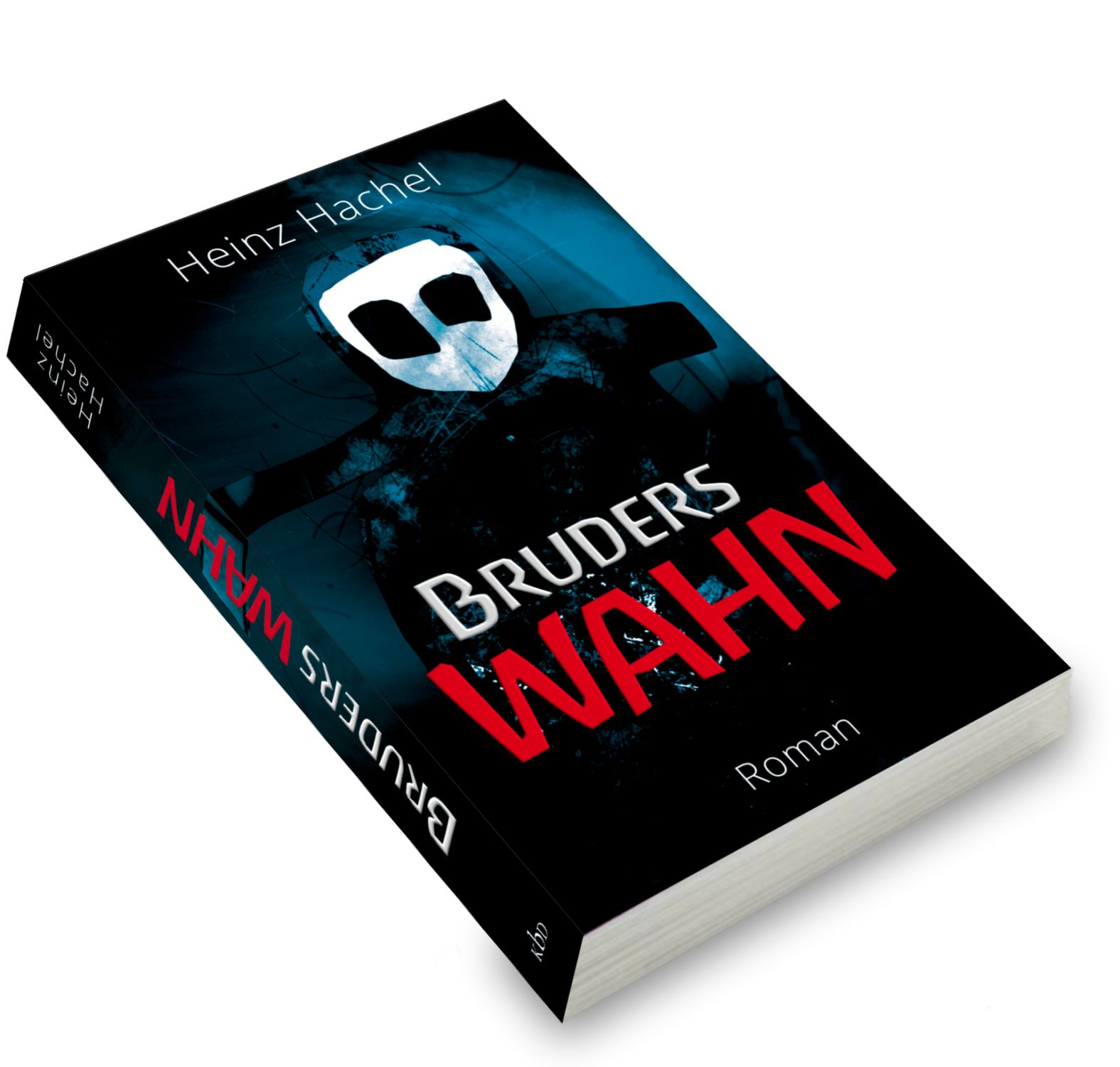Auszug aus „Bruders Wahn“, Seite 9 – 13
Fast liebevoll drapierten die drei Männer den leblosen Frauenleib auf den Gleisen. Ihre Wange ruhte auf kühler Schiene. Null Uhr dreißig. Während ein D‑Zug sich dumpf sirrend näherte, erzitterte eine Strähne ihres schwarzgelockten Haares. Ein Blatt Papier, eng und krakelig beschrieben und mit einem Stein beschwert, flatterte an den Rändern wild auf, als der Zug ratternd passierte. Wie ein letztes Winken. Weil ich die Welt nicht mehr ertrage, stand da. Gott, vergib mir. Hannelore.
+ + +
Curt Boehringer erwachte. Sofort waren sie wieder da, diese ewig alten Fragen: Was habe ich gewusst? Warum haben sie mich belogen? Werde ich jemals die Wahrheit erfahren?
Doch seine grauen Zellen ließen ihn im Stich. Nein, da war nichts. Wie immer. Nichts. Hatte er es wirklich gewusst? Als Kind gewusst, wer seine leibliche Mutter war? Ja! Zumindest signalisierte das sein limbisches System. Denn als er mit dreißig Jahren zum ersten Mal das Original seiner Geburtsurkunde in den Händen hielt, da war ihm dieses vergilbte Stück Papier zwar unsagbar fremd erschienen, zugleich aber auch merkwürdig vertraut. Wie durch eine Nebelwand hatte er auf das Dokument gestarrt. Minutenlang. Dann dieser hysterische Lachanfall. In die Knie war er gegangen, mit schmerzendem Zwerchfell, nach Luft schnappend wie ein Fisch auf dem Trockenen. Musste er das nicht als eine Art Übersprungshandlung deuten, als groteske Reaktion auf das Gewahrwerden des Verdrängten? Oder war es doch nur ein schnöder Reflex gewesen und allein der Absurdität der Situation und seiner Unwissenheit geschuldet?
Vierundzwanzig Jahre waren seitdem vergangen, fast ein Vierteljahrhundert, seit Gustav und Irene Boehringer – die Menschen, die er damals für seine Eltern hielt und die es gefühlt noch immer waren – in grausiger Zweisamkeit den Tod gefunden hatten. Erstickt im Schlaf. Laut Polizeibericht ein Unfall, einer dieser tragischen und überflüssigen, verursacht von einer glimmenden Zigarette, die der Hand des Einschlafenden entgleitet. Dabei hatte seine Mutter ihren Mann, diesen passionierten Raucher, doch wieder und wieder ermahnt, dass sein ewiges Quarzen im Bett sie noch beide ins Grab bringen würde. Doch Gustav Boehringer hatte stets nur sein verschmitztes Lächeln aufgesetzt. Wann und wo er rauche, sollte es wohl sagen, sei allein seine Sache. Da rede ihm niemand hinein.
Der Tod seiner Eltern markierte den traurigen Höhepunkt einer mit Schmerz und Verwirrung erfüllten Zeit.
Herbst 1989. Das Land im Taumel der Maueröffnung – Gustav und Irene Boehringer, wenige Wochen vor dem eigenen Tod, gelähmt vom Verlust ihrer einzigen Tochter. In den letzten Tagen ihres Lebens hatte er die beiden kaum gesehen. Zwei Besuche, ein paar Telefonate, endloses Schweigen. Wie hätte er sie auch trösten sollen?
Er konnte sich genau an den Anruf seines Vaters und dessen brüchige Stimme erinnern. Ein Sonntagmorgen war es gewesen, und früh, gegen sechs Uhr. Keine Begrüßung.
Es ist etwas Schreckliches passiert.
Ist was mit Mutti?
Hanne ist tot. – Pause. Schweres Atmen. – Deine Schwester hat sich vor einen Zug geworfen.
Stumm hatte er auf das Telefon gestarrt. Hannelore tot. Und er? Ganz ohne Gefühl. Er saß da und wartete, wartete auf das schmerzhafte Rumoren in den Eingeweiden, wartete vergebens. Einen Augenblick lang schien es ihm gar, als verspüre er Erleichterung. Klammheimliche Freude? Aber wie konnte das sein? Hanne war doch seine große Schwester.
Das Leid der Eltern hingegen vermochte er kaum zu ertragen. So klein und verloren hatten sie an diesem trüben Herbstmorgen vor der Friedhofskapelle gestanden. Auf dem Weg zum Grab musste er seinen zitternden Vater stützen. Seine Mutter hatte Halt am Arm des Pastors gefunden.
Diese Szenerie würde er auf ewig im Gedächtnis behalten. Den feinen Nieselregen, der vom Herbstwind getrieben auf der Haut prickelte, die Kühle der Luft, die den Geruch des nahenden Winters barg, und das welke Laub, das von Windböen getragen um die Füße der einsamen Prozession wirbelte. Nur seine Eltern, er, der Pfarrer und die Sargträger waren anwesend, als sich Hannes Sarg, begleitet von trostlosen Phrasen der Auferstehung und der Unsterblichkeit, hinab in die erdige Gruft senkte. Kein Leichenschmaus, nur ein Taxi, das erst seine Eltern, dann ihn selbst nach Hause brachte.
Vier Wochen später: der Besuch zweier Polizisten in Zivil. Als sie klingelten, blickte er gerade aus dem Fenster. Strahlend blauer Himmel, eiskalt und hoch oben, wie hingetupft, ein Band weißer Kumuluswolken.
Sind Sie Curt Boehringer, der Sohn von Gustav und Irene Boehringer? Erschrockenes Kopfnicken. Wir haben eine traurige Nachricht für Sie.
Nach der Identifizierung seiner Eltern war er lange und wie betäubt durch die Straßen geirrt – allein mit all dem Ungesagten. Ich liebe euch, ich danke euch für alles, was ihr mir ermöglicht habt. Worte wie diese waren nie über seine Lippen gekommen. Nun stand er da: der Letzte der Familie Boehringer. Schlusspunkt der Generationenfolge.
An die darauffolgenden Wochen konnte er sich nur bruchstückhaft erinnern. So vieles musste er in diesen Tagen bewältigen: die Beerdigung organisieren, die Trauerkorrespondenz erledigen, den Nachlass sichten und den Haushalt auflösen. Dabei hatte er dieses Papier gefunden, die Geburtsurkunde eines Kindes mit dem Namen Curt Nikolas, eines Kindes, das er, Curt Boehringer, einst war. Und das sich jetzt, nach so langer Zeit, fragte, was damals geschehen sein mochte, das aus den Großeltern die Eltern und aus seiner leiblichen Mutter die Schwester gemacht hatte. Was für ein Chaos!
Sechs Jahre zählte er, als Gustav und Irene – beide bereits Mitte vierzig – ihn an Kindes statt annahmen.
Gib uns den Jungen, sonst bring ich mich um. Dieser Satz war ihm vor Jahren von einer ehemaligen Nachbarin zugetragen worden – einer von vermutlich vielen ähnlichen Sätzen, mit denen seine Großmutter ihrer Tochter den Enkel abgepresst hatte. Als Kitt für eine desolate Ehe, wie von der Nachbarin behauptet? Mag sein, denn Irene Boehringer war – neben ihren liebenswerten Wesenszügen – eine verbitterte und still leidende Frau gewesen, die ihre Familie unentwegt mit Schuldgefühlen traktierte: Wenn ich mal tot bin, werdet ihr schon sehen, was ihr an mir hattet. Dann ihr Interesse an gar nichts, außer dieser ewigen Tratscherei mit den Nachbarn. Schwer zu ertragen für seinen Großvater. Der hatte Zuflucht im Hobbykeller gefunden. Asyl bei Märklin, Super 8 und Porno.
Gehst du wieder in deine Räucherstube? Weniger eine Frage war es, eher eine resignierte Feststellung, die sich unzählige Male aus dem Mund seiner Großmutter quälte, wenn ihr Mann, längst Rentner, sich nach dem Essen erhob, die Schachtel Muratti Filter in die Brusttasche seines Hemdes stopfte und in sein Zwanzigquadratmeter-Refugium hinabstieg.
Sein Kellerreich, nannte er es. Dort unten waren die mit Styropor verkleideten Wände, die hinter bunten Vorhängen verborgenen Regale, alle Utensilien mit einer Patina aus altem Zigarettenqualm überzogen – Nachlass Abertausender von Lungenzügen.
Ungezählte Stunden hatte er selbst an diesem Ort verbracht. Heimliche Lektüre schlüpfriger Literatur. Erste Erfahrungen mit dem eigenen Körper. Experimente mit der Super-8-Kamera – kurze Trickfilmsequenzen: Ein Plastik-Godzilla wütet auf der Modelleisenbahn, ein Raumschiff durchquert die endlosen Weiten einer schwarzen DIN-A0-Pappe, und kleine grüne Aliens ruckeln über bizarre Landschaften aus Pappmaché.
Doch da gab es noch etwas in diesem Keller, tief vergraben in seinem Kopf und entnabelt von seiner Erinnerung – ein Messer, eingeschlagen in weißem Baumwolltuch. Er hatte es zufällig in einem ausrangierten Tonbandgerät entdeckt, in dem er drei Ausgaben der Zeitschrift frivol verstecken wollte. Im aufgeschraubten und entkernten Gehäuse lag es dann … dieses Messer. Darunter ein Papierkuvert und eine transparente Plastiktüte mit rotbraun verfärbten Stofffetzen. Dreizehn war er damals. Alt genug, um intuitiv zu begreifen, dass er das Gerät wieder zuschrauben, an seinen Platz stellen und kein Wort über seine Entdeckung verlieren sollte.
Er hatte nicht den Hauch einer Vorstellung, was es mit diesen Fundstücken auf sich hatte. Und er wollte sie auch nicht haben. Er liebte seine Eltern. Und so vergaß er jenen Nachmittag, wie er all die anderen dunklen Stunden und Tage vergessen hatte, die einst seine kindliche Seele verstörten.